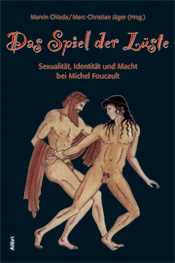Vorwort
„Womit kann man spielen und
wie ein Spiel erfinden?“
Michel Foucault
Foucault hat Erotik und Sexualität als Formen strategischer Spiele betrachtet, deren Regeln ebenso verändert wie verworfen werden können. Nicht die „Wahrheit des Geschlechts“ aufzudecken oder „sich selbst zu finden“ ist sein Thema, sondern die Möglichkeit, neue Lüste zu erfinden und ihren Gebrauch zu erweitern. Entsprechend skeptisch stand Foucault nicht nur der traditionellen, heterosexuellen Konstitution des Subjekts und dessen Institutionen, sondern auch zahlreichen Forderungen der sich seinerzeit politisierenden Schwulenbewegung gegenüber, für die er sich bis zu seinem Tod im Juni 1984 engagierte. Als Teil der eigenen Freiheit wie des individuellen Verhaltens, so Foucault, sei Sex weit mehr eine „gestaltende Kraft“ und weniger Schicksal. „Wir müssen nicht entdecken, dass wir Homosexuelle sind“, betont er daher mit Nachdruck.
Weit dringender als eine Wissenschaft der Sexualität sei eine schwule Lebenskunst, eine Kunst, die es möglich macht, vielfältige Formen von Beziehungen und Freundschaften zu fördern und auszukundschaften: „Nach unserem Verhältnis zur Homosexualität fragen heißt eher, sich eine Welt zu wünschen, in der solche Beziehungen möglich sind, als einfach nur ein sexuelles Verhältnis zu einer Person gleichen Geschlechts wollen, wenngleich auch das wichtig ist.“ Kurz, die Idee einer wie auch immer gearteten Identität hält Foucault für kontraproduktiv und unbrauchbar. Brauchbar scheint sie ihm lediglich dann, wenn sie als (offenes) Spiel, als ein „Prozedere von lustvollen – sozialen und sexuellen – Beziehungen“ erscheint. Werde dagegen die Identität zum Problem der Existenz, bestehe die Gefahr, einer Ethik zu verfallen, die sich an der traditionellen heterosexuellen Konstruktion von Männlichkeit, Ehe und Familie orientiert und diese damit reproduziert, statt zu verlassen. In einem von der Zeitschrift The Advocate (7. August 1984) postum publizierten Gespräch führt Foucault dazu aus: „Wenn wir zur Frage der Identität Stellung nehmen müssen, dann sollte es um Identität zu unserem eigenen Selbst gehen. Aber die Beziehungen zu uns selbst, sind keine identitären; viel eher sind sie Beziehungen von Differenzierung, Kreierung und Erfindung. Stets dasselbe zu sein, ist wirklich langweilig. Wir müssen Identitäten nicht verwerfen, wenn Leute dadurch ihr Vergnügen finden, aber wir müssen Identität auch nicht als eine ethisch universale Regel verstehen.“
Gegenstand von Das Spiel der Lüste ist die von Foucault aufgeworfene Frage nach dem Verhältnis von Sexualität, Identität und Macht. Dieses Verhältnis zu analysieren, hat Foucault insbesondere in seinen Studien zu Sexualität und Wahrheit unternommen, drei Bände, die eine vielfältige, überaus breite Rezeption erfahren haben, vor allem in Postfeminismus, Queer- und Gender Studies. Im Gegensatz zu diesen gängig gewordenen „dekonstruktivistischen“ Adaptionen Foucaults waren die Autorinnen und Autoren der vorliegenden Textsammlung bemüht, sich möglichst nah am Original abzuarbeiten. Nicht nur sollten die Positionen Foucaults vorgestellt und diskutiert, sondern darüber hinaus der Einstieg in dessen Terminologie und Arbeitsweise auch und gerade für interessierte Leserinnen und Leser ohne größere Vorkenntnisse „schmackhaft“ gemacht werden. Am Anfang steht daher eine umfangreiche Einführung von Marc-Christian Jäger in den zentralen Begriff der Macht und seine Bedeutung für Foucaults Analyse des Sexualdispositivs, der Körpertechnologien und der Selbstsorge. Im Anschluss daran folgt ein kurzer Abriss von Annette Schlemm zu Foucaults Konzeption einer „neuen Lebenskunst“ mit Blick auf Subjekt und Homosexualität sowie das darin schlummernde „utopische“ Potential. Marvin Chlada skizziert in seinem Beitrag Foucaults Kritik des Wunschbegriffs, wie er von Deleuze, Guattari und Lyotard gegen den klassischen Freudomarxismus in Form einer Libidoökonomie ins Feld geführt wurde. Foucaults Aufforderung, das Werk von Max Stirner aus dem Blickwinkel der Techniken des Selbst zu analysieren, ist Jürgen Mümken gefolgt. Sein Beitrag stellt die Bedeutung und Problematisierung von Geschlecht und Identität bei Stirner und Foucault gegenüber. Sodann widmet sich Marc-Christian Jäger der Differenz von sadistischer Disziplinarmacht und sadomasochistischer Subkultur. Ausgangspunkt dafür bildet Foucaults Rezeption von Sade und Bataille. Im letzten Beitrag zeichnet Andrea D. Bührmann im Anschluss an Foucaults Analyse moderner Subjektivierungsweisen den Weg vom Begehrens-Subjekt hin zum neoliberalen unternehmerischen Selbst nach.
Bleibt nur mehr anzumerken, dass im Rahmen dieses Bandes vieles auf der Strecke bleiben musste, was in Bezug auf Sexualität, Identität und Macht bei Michel Foucault noch zu formulieren gewesen wäre, sei es die Frage nach der (konkreten) Qualität „neuer Beziehungen“ oder die Probleme und Konsequenzen, die sich aus Foucaults Fragestellungen für eine Politik der Identität, der homosexuellen Liebe und Verhaltensweisen, des Fetischismus und Sadomasochismus usw. ergeben. Kurz, was Foucault in kleinen Texten und Gesprächen lediglich angedeutet oder angerissen hat, wartet noch auf eine Aufarbeitung und Weiterführung. Selbiges gilt für die Aufsätze der Autorinnen und Autoren dieses Bandes, die sich in erster Linie Foucaults Diktum verschrieben haben: „Je offener das Spiel ist, desto verlockender und faszinierender ist es.“
Mai 2008
Marvin Chlada und Marc-Christian Jäger